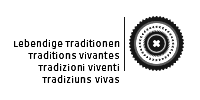Das «Galgenfischen», das Fischen mit einem sogenannten «Fischergalgen», hat sich seit dem Mittelalter entwickelt. Die überlieferte Form der Netzfischerei gilt als äusserst schonende Fangart. Dabei wird in unmittelbarer Ufernähe in einem sogenannten «Hinterwasser» – eine durch ein Wehr entstehende rückläufigen Strömung –, ein Netz mittels eines Kurbelzugs ins Wasser gesenkt. Fische, die sich auf ihrem Weg flussaufwärts ausruhen wollen, schwimmen dabei direkt an diese Stellen. Die Fischenden überprüfen den Fang, den sie mit dem Netz aus dem Wasser ziehen, und können die Fische je nach Art, Grösse und Schutzstatus unverletzt wieder zurück ins Wasser entlassen. Die Personen, denen die Fischergalgen gehören, pflegen damit eine historische und nachhaltige Art der Fischerei. In der Stadt Basel sind sie in einem Verein organisiert. Dieser setzt sich für den Erhalt der Fischergalgen, für die Weitergabe des jahrhundertealten Wissens rund um die Fischerei im Rhein und für den Umweltschutz im und am Gewässer ein.
Das Galgenfischen verweist auf die einst grosse Bedeutung der Fischerei für die Bevölkerungen am Rhein. Sie bot nicht nur eine wichtige Einkommensquelle für die ansässigen Fischerfamilien, sondern auch für die jeweiligen Eigentümer der sogenannten «Fischenzen», der Fischereirechte. Besonders wichtig war dabei der «Salm», wie der Lachs im Frühlingshalbjahr genannt wurde. Mit der zunehmenden Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts, der Begradigung des Rheins für die Grossschifffahrt und dem Bau von Wasserkraftwerken nahmen die Fischbestände stark ab. Die letzten Lachse oberhalb von Basel wurden Ende der 1950er Jahre gefischt.